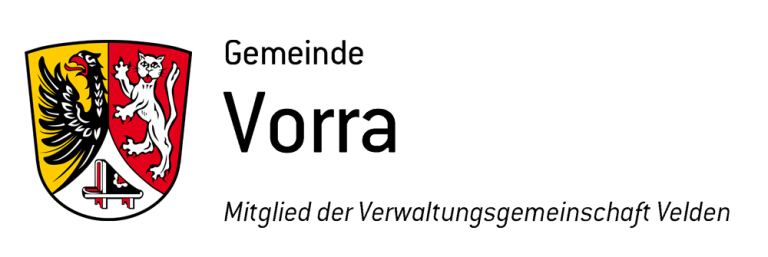Vorra und seine Umgebung haben einen ganz besonderen Lebensraum, den Dolomit-Kiefernwald. Eine ganze Reihe wunderschöner Pflanzenarten sind daran angepasst. Vorra kann einen Teil von ihnen den Besuchern und Bewohnern zeigen, ohne dass dabei die Natur beeinträchtigt wird.
Im Rahmen der Projekte „Biotopkomplex Kiefernwälder und Trockenrasen der Dolomitkuppenalb“ und „Mittelfrankenstauden“ wollen wir gemeinsam ermöglichen, die schönen Pflanzen in einem Rahmen zu erleben, der Natur schützt, aber zeigt, worauf man in der Umgebung Vorras stolz sein kann.
Die Pflanzen werden über den Sommer herangezogen und im Herbst dann in der Stöppacher Straße (unterhalb der Hausnr. 10) gepflanzt.

Vorra und seine Umgebung haben einen ganz besonderen Lebensraum, den Dolomit-Kiefernwald. Eine ganze Reihe wunderschöner Pflanzenarten sind daran angepasst. Vorra kann einen Teil von ihnen den Besuchern und Bewohnern zeigen, ohne dass dabei die Natur beeinträchtigt wird.
Im Rahmen der Projekte „Biotopkomplex Kiefernwälder und Trockenrasen der Dolomitkuppenalb“ und „Mittelfrankenstauden“ wollen wir gemeinsam ermöglichen, die schönen Pflanzen in einem Rahmen zu erleben, der Natur schützt, aber zeigt, worauf man in der Umgebung Vorras stolz sein kann.
Die Pflanzen werden über den Sommer herangezogen und im Herbst dann in der Stöppacher Straße (unterhalb der Hausnr. 10) gepflanzt.

Diese Arten der Dolomit-Kieferwälder sollen einen Platz in Vorra finden:
- Genfer Günsel (Ajuga genevensis)
- Großes Windröschen (Anemone sylvestris)
- Rispige Graslilie (Anthericum ramosum)
- Wundklee (Anthyllis vulneraria)
- Rindsauge (Buphthalmum saliciifolium)
- Golddistel (Carlina vulgaris)
- Wirbeldost (Clinopodium vulgare)
- Kartäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum)
- Zypressen-Wolfsmilch (Euphorbia cyparissias)
- Gewöhnliches Sonnenröschen (Helianthemum nummularium)
- Wiesen-Schlüsselblume (Primula veris)
- Gewöhnliche Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris)
- Kalk-Blaugras (Sesleria caerulea)
- Straußmargerite (Tanacetum corymbosum)
Hier finden Sie weitere Infos zu den obengenannten Pflanzen.

Das Projekt "Mittelfranken-Stauden" - Vom Wert heimischer Pflanzenarten und ihrer Schönheit auf öffentlichen Flächen erzählen
In Zusammenarbeit mit Kommunen und Vereinen werden öffentliche oder öffentlich zugängliche Flächen mit heimischen Stauden bepflanzt. Ergänzend erfolgt Öffentlichkeitsarbeit zum Wert heimischer Pflanzen, besonders für Wildbienen und Schmetterlinge.
Ziele:
Heimische Pflanzenarten regionaler Samenherkunft sind wertvoll für die Artenvielfalt. Viele Tierarten sind von bestimmten Pflanzen abhängig. Auf kommunale Flächen können sie präsentiert werden, ohne dass die Natur durch Menschenmengen geschädigt wird (Negativbeispiel: Märzenbecher-Wald).
Wer den ökologischen Wert heimischer Stauden kennt, wird sie möglicherweise auch im heimischen Garten pflanzen (aber nicht in der freien Natur ausgraben). Für die Arten, die im Rückgang befindlich sind, entstehen dann neue Refugien.
Innerhalb des Projektes und mit weiteren Partnern wird gerade ein Netzwerk von Gärtnereien aufgebaut, in denen man heimische Arten regionaler Herkunft beziehen kann.
Zum Projekt wird auf unterschiedliche Weise Öffentlichkeitsarbeit gemacht: Eine Infotafel steht an der Fläche, Vorträge für Bauhofmitarbeitende (in Zusammenarbeit mit der Kreisfachberatung) und für die breite Bevölkerung ergänzen sich mit Presseartikeln und anderen Medieninhalten.